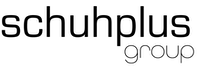Manchmal sind die größten Wunderwerke der Natur fast unsichtbar. Sie liegen in der feuchten Nase eines Hundes, einem Organ, das mit bis zu 300 Millionen Geruchsrezeptoren ausgestattet ist – ein schier unvorstellbarer Unterschied zu den rund fünf Millionen des Menschen. Diese Fähigkeit erlaubt es Hunden, Gerüche zu trennen, Spuren zu verfolgen und buchstäblich Geschichten zu riechen, die in der Luft hängen. Jede Hundenase ist dabei so einzigartig wie ein Fingerabdruck. Es ist diese außergewöhnliche Gabe, die den besten Freund des Menschen zu einem unschätzbaren Partner bei der Suche nach vermissten Personen macht. Doch diese Helden auf vier Pfoten werden nicht geboren, sie werden gemacht – durch unermüdliches Training und die Hingabe ihrer menschlichen Partner. Die Rettungshundestaffel Weser-Ems, gegründet im Jahr 1995, ist heute eine der am häufigsten angeforderten Hundestaffeln im norddeutschen Raum. Über diese faszinierende Welt der Rettungshundearbeit, die Herausforderungen und die emotionalen Momente sprachen Nicole Pasch und Christoph Henke von der Rettungshundestaffel Weser-Ems im TV-Studio von „Trude Kuh“ mit Redaktionsleiter Georg Mahn.
Ehrenamt mit Blaulicht-Anschein: Ein Verein auf Spenden angewiesen
Wer die Mitglieder der Rettungshundestaffel Weser-Ems in ihrer professionellen Ausrüstung bei einem Einsatz oder einer Übung sieht, könnte sie leicht für eine staatliche Einheit halten. „Viele, die uns sehen, mit dem Logo denken, wir sind halt Polizei“, erklärt Christoph Henke. Dieser Eindruck ist weit verbreitet, aber grundlegend falsch. Die Realität sieht anders aus: Die Staffel ist ein gemeinnütziger Verein, der sich ausschließlich durch Mitgliedsbeiträge und Spenden finanziert. Jeder Einsatz, jede Fahrt zum Trainingsort und jedes Ausrüstungsteil wird aus eigener Tasche oder durch die Unterstützung von Gönnern bezahlt. „Wir sind halt wirklich auf Spenden angewiesen“, betont Henke. Die persönliche Schutzausrüstung (PSA), die für jeden Helfer obligatorisch ist, kann schnell Kosten im vierstelligen Bereich verursachen. Ein Helm, spezielle Kleidung, Funkgeräte – all das muss selbst angeschafft werden, da keine Zuschüsse von Behörden erfolgen. Diese finanzielle Belastung ist ein ständiger Begleiter der ehrenamtlichen Arbeit und macht deutlich, wie wichtig die „Trude Kuh“ Vereinsförderung und ähnliche Initiativen für das Überleben solcher Organisationen sind. Die Mitglieder, die aus den unterschiedlichsten Berufsfeldern wie der IT kommen, eint dabei ein gemeinsamer Antrieb: der Wunsch zu helfen, etwas zu bewirken und etwas Sinnvolles mit ihrem Hund zu tun. Die Staffel wird vorrangig für die Suche nach vermissten Personen angefordert, unabhängig von deren Alter, sei es ältere Menschen aus Seniorenheimen oder auch Kinder.
Mantrailing und Flächensuche: Die anspruchsvolle Ausbildung von Mensch und Hund
Die Arbeit der Rettungshundestaffel Weser-Ems gliedert sich in zwei Hauptdisziplinen: das Mantrailing und die Flächensuche. Beim Mantrailing folgt der Hund, an der Leine geführt, dem Individualgeruch einer bestimmten Person. Dafür erhält er einen Geruchsartikel, etwa eine Zahnbürste, die nur die gesuchte Person angefasst hat, und verfolgt die Spur durch urbanes Gelände (Städte, Dörfer). „Quasi der Ort, wo die Person zuletzt gesehen wurde“, so Christoph Henke. Die Flächensuche hingegen kommt in großen, unübersichtlichen Gebieten wie Wäldern oder Wiesen zum Einsatz. Hier suchen die Hunde frei und ohne Leine ein Areal von mindestens 50.000 Quadratmetern systematisch nach menschlicher Witterung ab. Oft arbeiten beide Sparten Hand in Hand: Ein Mantrailer kann den Weg einer vermissten Person bis zu einem Waldstück verfolgen, wo dann die Flächenhunde die Suche übernehmen.
Die Ausbildung zu einem solchen Rettungshundeteam ist lang und intensiv. „So im Schnitt sagen wir, so zwei Jahre mindestens dauert die Ausbildung, bis du in die Prüfung gehen kannst“, erläutert Nicole Pasch. Die Staffel ist zertifiziert und legt entsprechende Prüfungen ab. Voraussetzung ist nicht eine bestimmte Rasse – in der Staffel finden sich vom Corgi bis zum Australian Shepherd wie dem mitgebrachten Ernie die verschiedensten Hunde –, sondern die Motivation und Eignung des Tieres. Hunde mit Plattnasen eignen sich beispielsweise weniger gut. Grundgehorsam sollte der Hund beherrschen. Das Training findet jeden Samstag statt und kann sechs bis acht Stunden dauern. Dabei wird nicht nur der Hund geschult, sondern auch der Mensch. Erste Hilfe am Menschen und am Hund, Einsatztaktik, Karten- und Kompasskunde sowie der Umgang mit GPS-Geräten gehören zum Pflichtprogramm. Der Hundeführer muss lernen, seinen Hund zu „lesen“, seine Signale zu deuten und die Suche strategisch zu lenken, beispielsweise durch das Beachten von Windrichtung und Witterung. Die Trainingsgebiete, unter anderem in Wiefelstede, werden regelmäßig gewechselt, da die Hunde schlau sind und sich Verstecke merken. Für den Hund selbst ist die Arbeit jedoch kein Zwang, sondern ein motivierendes Spiel, das auf seinem natürlichen Jagd- und Spieltrieb aufbaut und am Ende mit einer Belohnung (Futter oder Spielzeug) verknüpft ist.
Vom Alarm bis zum Fund: Der Ernstfall und die emotionale Belastung
Wenn der Alarm kommt, muss es schnell gehen. Über eine App melden die Mitglieder ihre Einsatzbereitschaft, und im Ernstfall klingelt das Telefon auch mal mitten in der Nacht. Dann heißt es, den fertig gepackten Rucksack und den Hund zu schnappen und loszufahren. Die Anforderung kommt dabei stets von offizieller Stelle, meist der Einsatzleitstelle der Polizei. „Wir dürfen gar nicht von alleine aus privater Sicht in einen Einsatz gehen“, stellt Nicole Pasch klar, da die Staffel der Behörde Katastrophenschutz angehört. Im Einsatz arbeiten die Teams eng mit anderen Organisationen wie der Feuerwehr, dem THW oder anderen Rettungshundestaffeln zusammen, um beispielsweise Straßen zu sperren oder größere Gebiete abzusuchen. Technische Hilfsmittel wie aufgeladene Taschenlampen mit Ersatzbatterien, Funkgeräte und GPS-Geräte sind dabei unerlässlich, um die Verbindung zur Abschnittsleitung zu halten und sich im unbekannten Gelände zu orientieren.
Doch bei aller Professionalität und Routine sind die Einsätze oft emotional belastend. Die Helfer werden mit dem Schicksal vermisster Menschen konfrontiert und müssen auch auf den schlimmsten Fall vorbereitet sein: den Fund einer verstorbenen Person. „Man hat immer so dieses Denken, es könnte ja auch nicht so gut ausgehen im Kopf“, gibt Pasch zu. Wichtig sei es, sich während des Einsatzes voll auf die Aufgabe zu konzentrieren, um den Hund nicht durch eigene Anspannung zu beeinflussen. Für die Verarbeitung solcher Erlebnisse steht den Mitgliedern der Austausch im Team und bei Bedarf auch professionelle Hilfe zur Verfügung. Mit Blick auf das 30-jährige Jubiläum im kommenden Jahr wünscht sich der Verein, der aktuell 21 aktive Mitglieder zählt, vor allem eines: weiterhin engagierte Mitglieder und die nötige Unterstützung, um ihre unverzichtbare Arbeit fortsetzen zu können. Im nächsten Jahr richtet die Staffel zudem das Bundestreffen des BZRH, ihres Dachverbandes, aus. Vereine wie dieser sind das Rückgrat der Gesellschaft, und vielleicht möchte auch Ihr Verein seine Geschichte erzählen. Dann können Sie hier einen Interview-Termin für Vereinsvorstellung anfragen.